Kontakt
Dr. Christiane Holm
Germanistisches Institut
Telefon: 0345 5523593
Telefax: 0345 5527067
christiane.holm@germanistik...
Raum 1.07.0
Ludwig-Wucherer-Straße 2
06108 Halle
Postanschrift:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Philosophische Fakultät II
Germanistisches Institut
06099 Halle
Dr. Christiane Holm

Handliche Bibliothek der Romantik Band 14: Zimmer
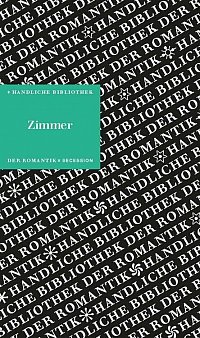
Handliche Bibliotek der Romantik, Band 14
Pressestimmen
Tilman Spreckelsen: Einleuchtend versammelt der von Christiane Holm herausgegebene Band „Zimmer“ neben wohlbekannten Texten wie Hoffmanns „Des Vettters Eckfenster“, Ludwig Tiecks „Des Lebens Überfluß“ oder Edgar Allan Poes „Das verrräterische Herz“ – allein diese drei deuten schon die Bandbreite des Themas an – eine Reihe schöner Trouvaillen wie ein Märchen von Sophie Tieck oder eine sehr lesenwerte, anonym überlieferte Auslegung der Funktion von Tapetentüren.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.1.2025
Handliche Bibliothek der Romantik
Band 5: Handarbeit

Handliche Bibliothek der Romantik, Band 5
Pressestimmen
Sabine Frank: „Dieser Band aus der Handlichen Bibliothek der Romantik ist weniger ein reines Lesevergnügen als vielmehr ein Exkurs durch eine Zeit des Umbruchs exerziert am Beispiel der Handarbeit.“ (MDR Kultur, Unter Büchern, 9.12.2020)
Cornelia Studthoff: „Allerreinstes Pleasure-Reading. Sowieso existierende Interessen gemütlich bedienen, um die Jahreszeit darf das. Plus: Es sieht sehr gut aus.“ (Logbuch Suhrkamp. Fremdlesen Weihnachten 2020 )
Frederike Middelhoff: „Christiane Holm versammelt in dieser bibliophile Herzen höherschlagen lassenden Ausgabe der Handlichen Bibliothek romantische 'Textilpoesien' vom Spinnen, Weben, Stricken, Sticken und Färben und veranschaulicht auf diese Weise den nicht nur metaphorischen Vorgang, mit dem die Romantik Stoffe verarbeitet, Fäden auf-nimmt, Vergangenheit und Gegenwart mal kritisch, mal subversiv, mal mythisierend, mal psychologisierend verwebt.“ (Goethe Spektrum 4/2020)
Johanna-Charlotte Horst: „… ein erhellender Handschmeichler.“ (Süddeutsche Zeitung, 24.11.2020)
Forschungsschwerpunkte
Literatur-, Kunst- und Kulturgeschichte vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert
• Dingkulturen
• Gartenkunst und Interieur
• Gedächtnis und Erinnerung
• Geschlechterkonzeptionen
Neuerscheinungen

Dinggeschichten II. Zyklographische Erzählungen des 18. und 19. Jahrhunderts (2024) Holm, Christiane/Wernli, Martina/Wildenauer, Johanna (Hg.): Dinggeschichten II: Zyklographische Erzählungen des 18. und 19. Jahrhunderts . Hagen 2024 (= Kabinettstücke: Sammlung literarischer Skurrilitäten). |
Dinggeschichten sind zyklographische Erzählungen des 18. und 19. Jahrhunderts. Die vorliegende Anthologie erweitert den Ansatz des Bandes „Dinggeschichten I“ um eine sachgeschichtliche Perspektive, die Materialitäten, Macharten und Gebrauchsformen der erzählenden Dinge in den Blick nimmt. Im Vordergrund steht hierbei das Wechselspiel zwischen materieller Kultur und Genrekonventionen. |
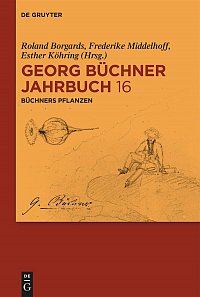
Georg Büchner Jahrbuch 16 (2024) Brautmyrten. Topfpflanzen bei Büchner und Brentano. In: Georg Büchner Jahrbuch 16 (2024), S. 89–114. |
Pflanzen sind bei Büchner von Beginn seines Schreibens an Thema und tauchen in bemerkenswerter Diversität und Fülle über das Werk verstreut auf. Vor dem Hintergrund der botanischen Forschung, der Stubengärtnerei und der Agrarwissenschaften sowie im Horizont der aktuellen Forschungsdynamik in den Plant Studies nehmen die Beiträge pflanzlich versierte Re-Lektüren der Texte Büchners vor und reflektieren dabei die Bedingungen und Konsequenzen der literatur- und kulturwissenschaftlichen Pflanzenforschung. |
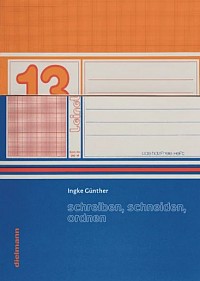
Ingke Günther: schreiben, schneiden, ordnen. Frankfurt am Main 2023. Macharten. Überlegungen zur Bildserie "immer was zu tun". In: schreiben, schneiden, ordnen. Hg. von Ingke Günther, Frankfurt am Main 2023, S. 14-21. |
Bildnerische Textarbeiten stehen im Fokus dieses Buches. Ingke Günther zeigt vorwiegend seriell angelegte Werke auf und aus Papier, in denen sie sich mit Schrift und Worten beschäftigt. Dabei ist sie sowohl an dem interessiert, was die Begriffe oder Phrasen inhaltlich transportieren, als auch an deren formbarer Gestalt. |
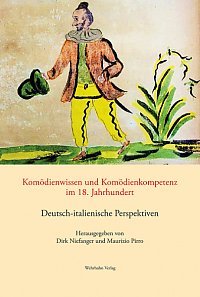
Niefanger, Dirk/Pirro, Maurizio: Komödienwissen und Bücher, Fächer, Uhren. Zum Spiel der Dinge in Konsum-Komödien des 18. Jahrhunderts. In: Niefanger, Dirk/Pirro, Maurizio: Komödienwissen und Komödienkompetenz im 18. Jahrhundert. Deutsch-italienische Perspektiven, Hannover 2024, S. 109-139. |
Dieser Band befasst sich mit der Komödie als soziale und ästhetische Praxis im deutschsprachigen 18. Jahrhundert und fokussiert dabei eine internationale Perspektive vor allem im Hinblick auf den italienisch-deutschen Kulturtransfer. Die gesammelten Aufsätze widmen sich eher implizit sichtbaren Konzepten von Komödien, bei denen ›Komödienwissen‹ und ›Komödienkompetenz‹ eine Schlüsselrolle innerhalb einer europäischen Entfaltung der Gattung spielen. Den Beiträgen liegt ein kulturwissenschaftlich erweiterter Wissensbegriff zugrunde, der unterschiedliche Textzeugnisse wie soziale Praxen ausdrücklich mit einschließt. In den Mittelpunkt rücken nicht nur die gängigen Komödientheorien der Zeit und die bekannten Exempel der Komödienkunst, sondern auch die mehr oder minder starken oder sichtbaren Markierungen in allen möglichen Bereichen der Kultur. |
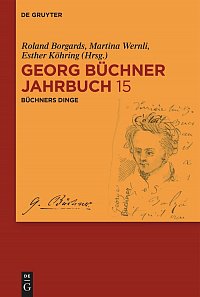
Georg Büchner Jahrbuch 15 (2023) Rede und Requisite. Komische Dinge in Büchners „Leonce und Lena". In: Georg Büchner Jahrbuch 15 (2023), S. 107–121. |
Die Dinge sind im Zuge des 'material turns' in den letzten Jahren zu einem zentralen Untersuchungsfeld der Literaturwissenschaften avanciert. Verbunden ist damit ein neues Verständnis der Dinge selbst: Dinge sind nicht nur passive Inskriptionsflächen für semantische Zuschreibungen, sondern oft auch voller Widerständigkeit oder gar geprägt von einer eigentümlichen Selbsttätigkeit, einer 'Wirkmächtigkeit' oder 'Agency'. Angesichts dieser Entwicklung ist es bemerkenswert, wie wenig bisher die Dinge bei Büchner in den Blick genommen wurden. Denn komplexe Dingkonstellationen finden sich in allen Werken Büchners, von den literarischen Texte über die naturwissenschaftlichen Schriften bis zu den Briefen. |

Kunsthandwerk ist Kaktus. Die Sammlung seit 1945. Handarbeit der Romantik. Zwischen Selbstzweck und Kunstwert. In: Kunsthandwerk ist Kaktus. Die Sammlung seit 1945. Ausstellungskatalog Museum für Angewandte Kunst Frankfurt am Main. Hg. v. Sabine Runde u. Matthias Wagner K. Stuttgart 2022, S. 284–485. |
Der Begriff Kunsthandwerk wirft genauso viele Fragen auf, wie es vorgefasste Meinungen dazu gibt. Mit ihm verbinden sich Individualität, Einmaligkeit, multiperspektivische Natur, dekoratives Potential, künstlerische Qualität und ein hoher Erlebniswert. Sein wahres Potential ist dabei einer immer noch viel zu kleinen Öffentlichkeit bekannt. Aus diesem Grund stellt sich das Museum Angewandte Kunst erstmals die Aufgabe, die eigene Sammlung des Kunsthandwerks aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu reflektieren und an den Schnittstellen zu Design und bildender Kunst zu untersuchen. |
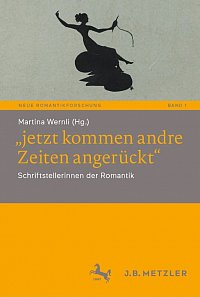
„jetzt kommen andre Zeiten angerückt“. Schriftstellerinnen der Romantische Handarbeiten. Text- und Textilpraktiken bei Bettine von Arnim und Helmina von Chézy. In: „jetzt kommen andre Zeiten angerückt“. Schriftstellerinnen der Romantik . Stuttgart 2022 (Neue Romantikforschung; 1), S. 31–54. |
Sie schrieben Romane, Erzählungen und Gedichte, sie übersetzten, pflegten umfangreichreiche Briefwechsel und verfassten philosophische Aphorismen: die Schriftstellerinnen der Romantik. Diese Aufsatzsammlung führt die Bestrebungen fort, die Werke der Romantikerinnen neu zu lesen. Wiederzuentdecken gibt es in diesem Band u.a. Benedikte Naubert, Dorothea Veit/Schlegel, Henriette Herz, Johanna Schopenhauer, Helmina von Chézy, Sophie Mereau, Henriette Schubart, Rahel Levin Varnhagen, Caroline de la Motte Fouqué, Jane Austen, Königin Luise, Bettina von Arnim, Adele Schopenhauer, Therese von Jakob-Robinson sowie Dorothea Tieck. |

Handliche Bibliothek der Romantik, Bd. 5: Handarbeit (2020) Handarbeit. Handliche Bibliothek der Romantik, Band 5. Berlin 2020. |
In romantischen Texten wird viel gesponnen, gestrickt und gewoben. Nimmt man den Faden auf, führt er in gesellschaftliche Kernbereiche, die in Bewegung geraten sind: das Geschlechterverhältnis und die Arbeitswelten. Hatte die Aufklärung die textile Handarbeit in der Mädchenerziehung disziplinierend eingesetzt, um Fantasien zu binden, entdeckte die Romantik das Gegenteil: Handarbeit setzt Fantasien frei und macht aus der vermeintlich überholten eine poesiefähige Tätigkeit. |
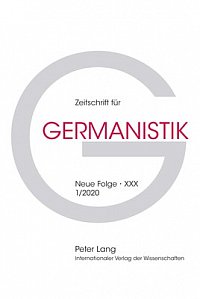
Zeitschrift für Germanistik 68 (2020) Das moderne Haus. Bau- und Wohnformen in der (Sach-)Literatur. Zeitschrift für Germanistik 68/2020. Hrsg. gemeinsam mit Ulrike Vedder. |
Das Themenheft knüpft an die aktuelle Konjunktur der literaturwissenschaftlichen Haus- und Architekturforschung an und akzentuiert die Perspektive dahingehend, dass es sich erstens auf die Moderne von der Neuen Sachlichkeit bis zur Gegenwart konzentriert und dabei zweitens nicht nur die durchgreifenden Modelle und Narrative, sondern vor allem die prosaischen Formationen der alltäglichen Praktiken fokussiert. Damit kommen auch Textsorten jenseits von Roman und Erzählung in den Blick, wie etwa die Reportage, der Ratgeber oder die Immobilienanzeige.
|
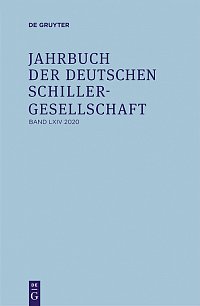
Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 64 (2020) Dichterhäuser. Überlegungen zu Bedingungen und Möglichkeiten eines unterschätzten Formats. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 64/2020, S. 359-372. |
The Yearbook of the German Schiller Society is an annual journal that primarily publishes essays on German-language literature from the Enlightenment to the present day. This time span coincides with the collections housed at the German Literary Archive in Marbach, which is under the stewardship of the German Schiller Society. Although studies on Schiller are especially welcome, they constitute only a portion of the journal’s spectrum.
|

Ausstellung Klopstockhaus, Begleitpublikation (2019) Wie der Körper zur Sprache kommt. Klopstock, Erxleben und Gutsmuths im papiernen Zeitalter. Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung im Klopstockhaus Quedlinburg. Hg. mit Maria Junker, Hannah Uhlen und Brigitte Meixner. Halle/Saale 2019. |
Papier ist in der Epoche der Aufklärung allgegenwärtig. Die buchkünstlerische Arbeit mit Falt-Texten von Studierenden der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle widmet sich drei Persönlichkeiten der Aufklärung, die sich in besonderer Weise mit Körper-Sprachen befasst haben: der Dichter Klopstock, die Ärztin Erxleben und der Pädagoge GutsMuths. Die Publikation begleitet die neue Dauerausstellung im Klopstockhaus in Quedlinburg und wurde in Zusammenarbeit mit dem Klopstockverein Quedlinburg realisiert. |



